Ripples
January 6th, 2019
Yesterday’s not here: Pete Shelley R.I.P.
Kurz nach dem Jahrtausendwechsel warfen Pete Shelley (geborener McNeish) und Howard Devoto (Trafford) für das Album Buzzkunst, nachdem sie über zwanzig Jahre ihre eigenen Wege gingen, nochmals ihre Kreativität gemeinsam in die Waagschale. Es sah es so aus, als ließe sich dieser überschwengliche Aufbruchsgeist von 1976, als sie gemeinsam die Buzzcocks gründeten, und, durch Punk angestachelt, aber die gängigen Machoattitüden gänzlich außer acht lassend, Großes vorhatten, wiederbeleben könnten.
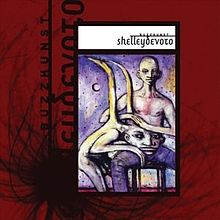
Buzzkunst wieß den Weg direkt in die Zukunft, und zwar in kühler Cutting Edge – Manier: Shelley und Devoto modellierten mit dem Handwerkszeug von fräsenden Gitarren, schwirrender Elektronik und Sequenzern melodische, treibende Songminiaturen, die, gepaart mit dem sperrigen Gesangsstil von Howard Devoto, perfekt funktionierten.
Devoto trieb hier seine Vorlieben, idiosynkratische Geschichten und Portraits über missliche Lebensläufe, die von einem Handbuch zur Symptombeschreibung von neurotischen Störungen inspiriert zu sein schienen, poetisch verschwurbelt in Songtexte zu verpacken, auf die Spitze.
Buzzkunst blieb aber das einzige gemeinsame Post-Buzzcocks- Zeugnis der beiden Ausnahmeküntler; history repeats itself: Schon nach der 1976 heiß erwarteten Veröffentlichung der Buzzcocks Debut-EP Spiral Scratch, erklärte Howard Devoto Punk kurzerhand als Schnee von Gestern und suchte das Weite. Er produzierte mit Magazine zwei wegweisende Alben im Post-Roxy Music Stil und zwei weitere, musikalisch um kommerziellen Erfolg bemühte und heute leider in der Zeit verhaftete und redundant klingende ein. Seinem Soloalbum – Jerky Versions of the Dream – und dem Nachfolgeprojekt Luxuria sollte das gleiche Schicksal beschieden sein. Trotz der hohen Qualität der Texte und zeitgeistiger musikalischer Verpackung ist die Figur Howard Devoto wohl zu artifiziell, um über einen Kultstatus hinaus Erfolg haben zu können.
Pete Shelley hingegen übernahm bei den Buzzcocks das Zepter der Leadfigur und schrieb für die Band (Steve Diggle komponierte auch den einen oder anderen wichtigen Song) mit bewundertswertem Leichtigkeit und Geschwindigkeit Power-Pop-Songs, und zwar für nichts weniger als die Ewigkeit. Das Herausfeuern von Singles im Zwei-Monate – Rhythmus und fast immer auf den vorderen Plätze der Charts zu landen, hatte man so seit Marc Bolan oder den Beatles nicht mehr erlebt. Anstatt über die alltägliche soziale Misere in Großbritannien zu referieren oder politische Slogans zusammenzuzimmern, ging es bei Shelley fast immer um libidinöse Nöte und amouröse Begegnungen und Träume. Und er hatte das Talent dazu, schwierige Gefühlszustände auf authentische und direkte Art auf den Punkt zu bringen: Griffige, elegante Gitarrenmusik mit intelligenten Lyrics und ohne aufgesetzte Rüpelattitüde; so hätte Punk auch sein können, wenn die Blaupause richtig verstanden worden wäre.

Und nebenbei, obwohl die Buzzcocks naturgemäß immer zuerst mit Punk in Zusammenhang gebracht werden, sollte man ihre Einflüsse, sei es Glam Rock, Roxy Music, Can oder Velvet Underground, nicht außer acht lassen. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass Jahrzehnte nach Erscheinen, ihre besten Stücke immer noch ungemein frisch und, ja, nahezu zeitlos klingen. Ganz im Gegensatz zu den meisten klassischen Punk-Hits, die im Vergleich doch schon arg verstaubt wirken und eher zur Gestaltung von Nostalgieabenden Verwendung finden.
Nach drei Alben löste Shelley die Band allerdings auf, um seine Musik in ein elektronisches Gewand zu kleiden und damit auf seine ursprünglichen Affinitäten zurückzukommen. Schon parallel zur Stammband spielte Shelley u.a. mit Eric Random als Tiller Boys experimentellere Musik. Zur epochalen Can – Kompilation Cannibalism schrieb er die Linernotes und auch hier lässt sich sein Talent, neben Fachwissen auch seine Begeisterung, zu Papier zu bringen, schwerlich übersehen. Pete Shelley hätte wohl auch einen kompetenten Musikjournalisten abgegeben, der Fantum- und distanzierte Professionalität vereinen hätte können (im Gegensatz zu z.B. einem mit dem NME kokettierenden und sich als zukünftiger Journalist sehenden narzisitischen Zeitgenossen aus der gleichen Stadt).
“In 1972 I would spend a few evenings a week at a friend’s house. He was interested in Hi-Fi and had a much better system than mine. We would talk and play records but only a few of the revords he played would do anything for me. One day he bought an album by a group called Can. The title – Tago Mago – . Since then I’ve been a fan. Some things I’ve loved to distraction. I used to play Hallelwah in the bath and You Doo Right in the dark at neighbour-hating levels. Listen to Father Cannot Yell on headphones and middle section twines itself around the brain. Other things at first hearing I’ve hated, but later had to admit that first-hearings are always misleading.”, so die Annäherung an die damals für britische Ohren noch befremdlichen Töne von Can.
Die erst 2016 erschienenen, aber schon 1976 in klassischer Bed-Room-Produktion aufgenommenen experimentellen Stücke Cinema Music und Wallpaper Sounds zeugen von Pete Shelleys Experimentiergeist. Mit einer Rhythmusmaschine und billigen Keyboards produziert, passen die montierten instrumentalen Stücke einerseits gut in eine Zeit, wo, etwas versteckt vom lauten Punk-Hype, musikalisch alles gleichzeitig möglich und erlaubt zu sein schien und das Spielen und Vermischen von allen Einflüssen und Vorlieben wie in einem Setzbaukasten selbstverständlich war.
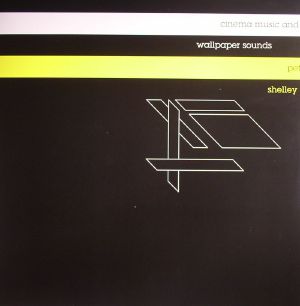
Bei den Stücken, die Shelley nur per Tape an interessierte Bekannte weiterreichte, kann man die düstere postindustrielle Atmosphäre eines desolaten Nord – Englands heraushören – Pyrolators Inland wäre das bundesdeutsche Pendant – aber auch die Einflüsse von den weitgehend noch unbekannten, aber wegweisenden deutschen Formationen und andererseits schon die zukünftige Synthie- und Dronemusik.
Nach der Auflösung der Buzzcocks startete Pete Shelley also eine Solo-Karriere und versuchte die Stärken von beiden Welten – fortschrittliche elektronische Musik mit eingängigen, direkten Songs – zu verbinden.
Auf Homosapien und XL1 (mit einer zusätzlichen Computer-Animation) funktioniert diese Symbiose von Stilen ziemlich gut. Die Singles Homosapien und Telephone Operator (erstere wurde aufgrund vermeintlicher Anstößigkeit wie schon Orgasm Addict von einigen Radiostationen boykottiert ) stehen den Buzzcocks-Songs in nichts nach, wurden aber eher zu Insider- als zu Chartserfolgen. Zu Beginn der Achziger war Shelley mit seiner Version von Elektronik-Pop immer noch seiner Zeit voraus und sein Projekt verlief sich schließlich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten im Sande.
Die spätere, mehrmalige Reformationen der Buzzcocks, die 1989 ihren Anfang nahm, und die von Zeit zu Zeit veröffentlichten Platten der Band, dürfen wohl eher den Hintergrund des Lebensunterhaltserwerbs als der Weiterentwicklung der musikalischen Ideen geschuldet sein und lassen auch die gewohnte Fokussierung vermissen.
Nachem Mark E. Smith am Anfang dieses Jahr starb, verliert Manchester mit dem überraschenden Tod von Pete Shelley am 6. Dezember einen weiteren, nicht zu ersetzenden Zeitgenossen. Keine gute Zeiten für die Rainy City.